
Das HST (Hubble Space Telescope) umkreist seit knapp
10 Jahren die Erde
 täglich etwa 15 mal in einer Höhe von knapp 600
Kilometern. Es wurde im
Aufrag der amerikanischen und europäischen Weltraumbehörden (NASA
und ESA)
gebaut. Jeder Astronom kann einen Antrag auf HST-Beobachtungszeit stellen,
über den ein unabhängiges Gremium allein nach
wissenschaftlichen Kriterien
täglich etwa 15 mal in einer Höhe von knapp 600
Kilometern. Es wurde im
Aufrag der amerikanischen und europäischen Weltraumbehörden (NASA
und ESA)
gebaut. Jeder Astronom kann einen Antrag auf HST-Beobachtungszeit stellen,
über den ein unabhängiges Gremium allein nach
wissenschaftlichen Kriterien
 entscheidet. Die verschiedenen Instrumente ermöglichen Photometrie
(Direktaufnahmen durch verschiedenen Filter) und Spektroskopie (Zerlegung
des Lichtes in Farben bzw. einzelne Spektrallinien) im sichtbaren
sowie im infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Lichtbereich. Anders als
Teleskope auf dem Erdboden kann das HST ungestört von der
Erdatmosphäre in
die Tiefen des All zu spähen. Dies hat drei Vorteile, die das
Weltraumteleskop wissenschaftlich gegenüber bodengebundenen Teleskopen so
wertvoll machen.
entscheidet. Die verschiedenen Instrumente ermöglichen Photometrie
(Direktaufnahmen durch verschiedenen Filter) und Spektroskopie (Zerlegung
des Lichtes in Farben bzw. einzelne Spektrallinien) im sichtbaren
sowie im infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Lichtbereich. Anders als
Teleskope auf dem Erdboden kann das HST ungestört von der
Erdatmosphäre in
die Tiefen des All zu spähen. Dies hat drei Vorteile, die das
Weltraumteleskop wissenschaftlich gegenüber bodengebundenen Teleskopen so
wertvoll machen.
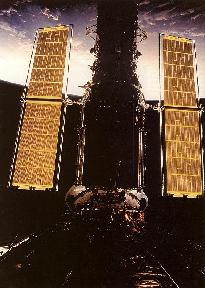 Das HST kann mit seinen fünf verschiedenen Instrumenten ganz
unterschiedliche Arten von Beobachtungen durchführen. Der Hauptspiegel ist
mit 2,4 Metern Durchmesser befindet sich etwa in der Mitte des Teleskopes.
Er wirft das Licht auf einen kleineren Fangspiegel, der es dann - durch ein
zentrales Loch im Hauptspiegel - auf die verschiedenen Lichtanalysegeräte
bündelt. Sonnensegel versorgen das HST mit der nötigen Energie. Die
digitalen Beobachtungsdaten werden dann über ein Antenne, die auch die
Steuerbefehle empfängt, zur Erde gefunkt.
Das HST kann mit seinen fünf verschiedenen Instrumenten ganz
unterschiedliche Arten von Beobachtungen durchführen. Der Hauptspiegel ist
mit 2,4 Metern Durchmesser befindet sich etwa in der Mitte des Teleskopes.
Er wirft das Licht auf einen kleineren Fangspiegel, der es dann - durch ein
zentrales Loch im Hauptspiegel - auf die verschiedenen Lichtanalysegeräte
bündelt. Sonnensegel versorgen das HST mit der nötigen Energie. Die
digitalen Beobachtungsdaten werden dann über ein Antenne, die auch die
Steuerbefehle empfängt, zur Erde gefunkt.
Die Astronomen der Universitätssternwarte München zählen zu den
intensivsten Nutzern des HST in Europa. Eine unserer Arbeitsgruppen
untersucht sehr weit entfernte
Galaxien, deren Licht viele Milliarden Jahre
bis zur Erde benötigt haben.
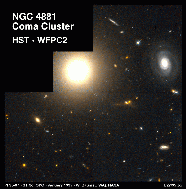 Galaxien sind Sternsysteme wie unsere
Milchstraße, die viele Milliarden Sterne enthalten. Durch erdgebundene
Teleskope erscheinen solch ferne Welteninseln , wenn überhaupt, nur als
schwach leuchtende, verwaschene Flecken. Das HST dagegen läßt
beispielsweise sogar noch die Spiralarme einer
Spiralgalaxien in vier
Galaxien sind Sternsysteme wie unsere
Milchstraße, die viele Milliarden Sterne enthalten. Durch erdgebundene
Teleskope erscheinen solch ferne Welteninseln , wenn überhaupt, nur als
schwach leuchtende, verwaschene Flecken. Das HST dagegen läßt
beispielsweise sogar noch die Spiralarme einer
Spiralgalaxien in vier
 Milliarden Lichtjahren Entfernung deutlich erkennen. Wir
konzentrieren uns an der Unisterwarte München jedoch auf die sogenannten
elliptischen Galaxien, die vorzugsweise in
Galaxienhaufen
zu finden sind, die wir bei
unterschiedlichsten
Entfernungen untersuchen. Elliptische Galaxien selbst dienen als
``Standard-Kerzen'' bei der Bestimmung der Geometrie des Weltraums als Ganzes:
Wir stellen uns vor, daß Weltraum ist gleichmäßig mit
elliptischen
Galaxien gleicher Helligkeit erfüllt. Sie erscheinen dann mit zunehmender
Entfernung immer schwächer, ein Effekt, der letztlich aus der Kombination
von drei Phänomenen beruht:
Milliarden Lichtjahren Entfernung deutlich erkennen. Wir
konzentrieren uns an der Unisterwarte München jedoch auf die sogenannten
elliptischen Galaxien, die vorzugsweise in
Galaxienhaufen
zu finden sind, die wir bei
unterschiedlichsten
Entfernungen untersuchen. Elliptische Galaxien selbst dienen als
``Standard-Kerzen'' bei der Bestimmung der Geometrie des Weltraums als Ganzes:
Wir stellen uns vor, daß Weltraum ist gleichmäßig mit
elliptischen
Galaxien gleicher Helligkeit erfüllt. Sie erscheinen dann mit zunehmender
Entfernung immer schwächer, ein Effekt, der letztlich aus der Kombination
von drei Phänomenen beruht:
Während die Hubble-Konstante H° schon recht gut bekannt ist, besteht
hinsichtlich q° noch große
Unsicherheit. Unser Ziel ist daher q°
mit Hilfe der elliptischen Galaxien Und dem HST sogenau wie möglich zu
messen. Natürlich sind elliptische Galaxien keine idealen Standardkerzen. Sie
bestehen aus unterschiedlich vielen Sternen, deren Helligkeit sich im
Laufe der Jahrmilliarden aufgrund ihres ``Alters'' ändert. Deshalb
müssen wir für jeden Entfernungsschritt den Durchschnittshelligkeit vieler
elliptischer Galaxien eines Haufens gerechnen. Die evolutionsbedingte
änderung dieser Helligkeit läßt sich durch zusätzliche spektoskopische
Beobachtungen korrigieren. Bereits aufgrund unserer ersten Beobachtungsreihe
konnten wir q° genauer bestimmen als je zuvor.