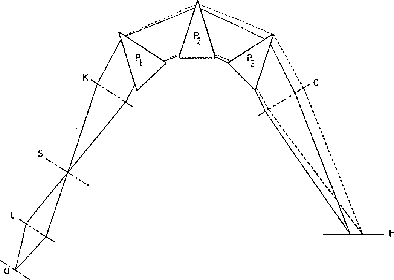
Der Praktikumsversuch besteht aus den folgenden Aufgaben:
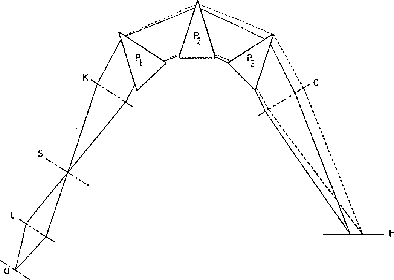
Die Versuchsanordnung (siehe Abbildung) setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
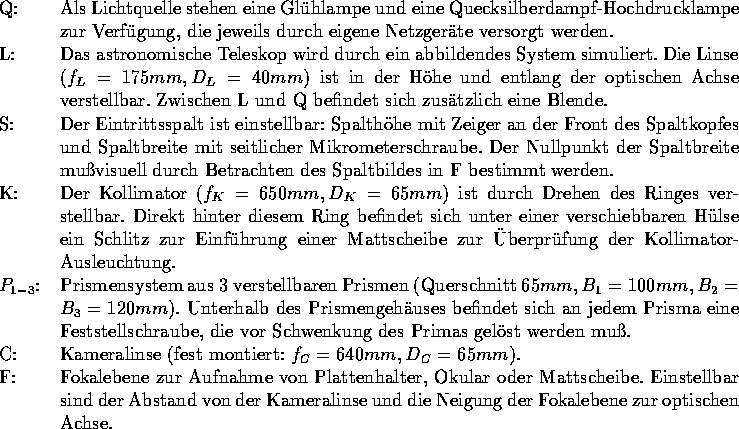
Justierung: Alle verstellbaren Teile sind arretierbar und
müssen vor dem Einstellen gelockert werden. Die Berührung der
Glasflächen, insbesondere der Prismen, ist unbedingt zu vermeiden.
Folgende Grundeinstellungen müssen überprüft werden:
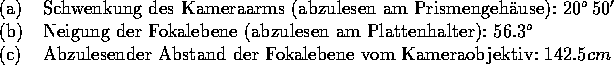
Die Abweichungen dieser Anordnung vom Strahlengang bei astronomischen
Anwendungen sind dadurch bedingt, daß
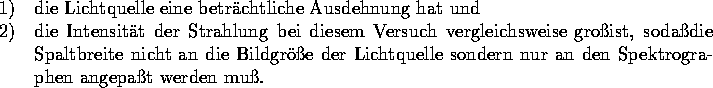
Aufgaben:
Leiten Sie das Auflösungsvermögen gemäß
(21) und (22) für den 3-Prismen- Spektrographen ab.
Berechnen Sie
die Größ e des Beugungsbildes  des Spaltes im
Kamerafokus und vergleichen Sie den Wert mit der geometrischen
Auflösung einer Photoplatte (
des Spaltes im
Kamerafokus und vergleichen Sie den Wert mit der geometrischen
Auflösung einer Photoplatte ( ). Die Spaltbreite wird
entsprechend dem größ eren der beiden Werte angepaß t. Prüfen
Sie, ob das zur visuellen Beobachtung benutzte Okular dem
Auflösungsvermögen des menschlichen Auges (1')
entspricht. Bestimmen Sie
). Die Spaltbreite wird
entsprechend dem größ eren der beiden Werte angepaß t. Prüfen
Sie, ob das zur visuellen Beobachtung benutzte Okular dem
Auflösungsvermögen des menschlichen Auges (1')
entspricht. Bestimmen Sie 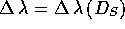 und
und  bei etwa 600 nm für die eingestellte Spaltbreite
bei etwa 600 nm für die eingestellte Spaltbreite
 rechnerisch und experimentell.
rechnerisch und experimentell.
Ausleuchtung: Wie im theoretischen Teil gezeigt wurde, muß
die maximal mögliche Bündelöffnung, die das Instrument zuläß
t, ausgenutzt werden. Mit einer zwischen Kollimatorlinse und
Prismengehäuse eingeführten Mattscheibe (Schlitz unter dem
Schiebering) ist zu prüfen, ob der Kollimator voll ausgeleuchtet
wird. Gegebenenfalls muß die äuß ere Abbildung L korrigiert
werden.
Justierung des Kollimators: Der Kollimator muß so
eingestellt werden, daß das austretende Lichtbündel genau parallel
verläuft. Wegen der äuß eren Konstruktion des Spektrographen
kann die übliche Autokollimations-Methode nicht angewandt
werden. Stattdessen wird der durch die Prismen verursachte
Astigmatismus benutzt, der bei parallelem Strahlendurchgang
verschwindet.
Hierzu wird zweckmäß igerweise die gelbe
Doppellinie der Hg-Lampe verwendet. Zunächst wird der Spalt so weit
wie möglich geöffnet (Drehung der Einstellschraube im
Uhrzeigersinn) und eine etwa gleich groß e Spalthöhe
eingestellt.
Die Position der Prismen wird soweit wie möglich vom
Minimum der Ablenkung entfernt , um den
astigmatischen Effekt zu verstärken. Betrachtet man das Spaltbild
der Spektrallinie mit dem Okular, so findet man jeweils 2 Positionen
der Fokalebene F (Abstand vom Kameraobjektiv), in denen jeweils die
horizontalen und vertikalen Spaltbegrenzungen scharf (minimal)
sind. Dabei muß das Auge auf das Fadenkreuz im Okular adaptiert
werden.
, um den
astigmatischen Effekt zu verstärken. Betrachtet man das Spaltbild
der Spektrallinie mit dem Okular, so findet man jeweils 2 Positionen
der Fokalebene F (Abstand vom Kameraobjektiv), in denen jeweils die
horizontalen und vertikalen Spaltbegrenzungen scharf (minimal)
sind. Dabei muß das Auge auf das Fadenkreuz im Okular adaptiert
werden.
Aufgabe: Tragen Sie die abgelesenen Positionswerte für
diese beiden Stellungen in einem Diagramm gegen die Kollimatorstellung
auf und bestimmen Sie den Schnittpunkt der beiden Kurven, der
diejenige Kollimatorstellung angibt, bei der für die betrachtete
Wellenlänge paralleles Licht vorliegt. Diskutieren Sie die Methode
anhand einer Fehlerabschätzung.
Aufgabe: Stellen Sie unter Verwendung der Mattscheibe jedes Prisma so ein, daß für eine ausgewählte Spektrallinie die Ablenkung minimal wird. Verbessern Sie diese Grobeinstellung iterativ unter Verwendung des Okulars. Geben Sie die Positionen der Prismen an und begründen Sie die iterative Verbesserung. Anzahl der Iterationen?
Neigung der Fokalebene: Infolge der Farbfehler des
Kameraobjektivs steht die Fokalebene nicht senkrecht zur optischen
Achse. Durch Fokussieren ausgewählter Linien des Hg-Spektrums (siehe
Anhang) kann  grob bestimmt werden.
grob bestimmt werden.
Aufgabe: Tragen Sie die gemessene Kamerabrennweite  als
Funktion der Wellenlänge für einige der Hg-Linien auf und
vergleichen Sie den Verlauf der Kurve mit dem erwarteten Gang für
eine Einzellinse,
als
Funktion der Wellenlänge für einige der Hg-Linien auf und
vergleichen Sie den Verlauf der Kurve mit dem erwarteten Gang für
eine Einzellinse, 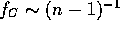 .
.
Diskussion der Linienspektren
Aufgabe: Betrachten Sie das Linienspektrum der Hg-Lampe und das Spektrum der Glühlampe.Vergleichen Sie das Erscheinungsbild und führen Sie es auf die physikalischen Grundlagen zurück.
Aufgabe: Vergleichen Sie einige Emissionslinien der Hg-Lampe
mit denen der Na-Flamme. Wie lassen sich die unterschiedlichen
Linienbreiten erklären? Wie die unterschiedliche Anzahl der Linien
im Visuellen?
Schätzen Sie aus Abstand und Breite der Na D-Linien
die spektrale Auflösung des Spektrographen.
Linienemission und -absorption
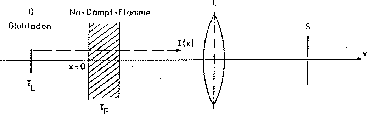
In der abgebildeten Anordnung Glühlampe + Na-Absorptionsplasma
(Bunsenbrenner mit Na- Verunreinigung) soll das kombinierte Spektrum
untersucht werden, wobei der Glühlampenstrom langsam erhöht wird
(Erhöhung von  ).
).
Die von der Glühlampe ausgehende Strahlung
hat annähernd eine Planck-Verteilung der Temperatur  ,
,

Es soll hier angenommen werden, daß in der Flamme die konstante
Temperatur  herrscht und daß das Plasma durch einen
Absorptionskoeffizienten
herrscht und daß das Plasma durch einen
Absorptionskoeffizienten  und einen
Emissionskoeffizienten
und einen
Emissionskoeffizienten  beschrieben werden kann, die
durch das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz verknüpft sind:
beschrieben werden kann, die
durch das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz verknüpft sind:

Auf dem Weg durch die Flamme ändert sich  entsprechend
entsprechend

Aufgaben: Lösen Sie die Differentialgleichung für
 . (Hinweis: man ersetzt
. (Hinweis: man ersetzt  durch die optische
Tiefe
durch die optische
Tiefe  ). Bestimmen Sie die Integrationskonstanten aus
). Bestimmen Sie die Integrationskonstanten aus
 (x=0) =
(x=0) =  . Beschreiben Sie die bei der
Erhöhung des Glühlampenstroms auftretenden 3 ausgezeichneten
Fälle und diskutieren Sie diese Fälle unter Berücksichtigung der
Lösung der Differentialgleichung.
. Beschreiben Sie die bei der
Erhöhung des Glühlampenstroms auftretenden 3 ausgezeichneten
Fälle und diskutieren Sie diese Fälle unter Berücksichtigung der
Lösung der Differentialgleichung.
Stellen Sie eine Beziehung zu den Verhältnissen in
Sternatmosphären her. Weshalb entstehen in Sternen
Absorptionslinien?