 gearbeitet wird und diese in Minuten unterteilt
werden. Nach obiger Formel negative HA sind also mit einer mod(24)-Rechnung
in positive Werte zu überführen.
gearbeitet wird und diese in Minuten unterteilt
werden. Nach obiger Formel negative HA sind also mit einer mod(24)-Rechnung
in positive Werte zu überführen.
Universitätssternwarte München
Institut für Astronomie und Astrophysik der
Ludwig-Maximilians-Universität München
Astrophysikalisches Praktikum
Beobachtungen mit der CCD-Kamera
Ulrich Hopp, 25.04.1997
Vorläufige Version, noch im Korrekturstadium
Inhalt:
Einführung für alle Teilversuche
Durchführung der Beobachtungen
Hinweise zur Handhabung von Teleskop und CCD-Kamera
Kurzanleitung zur Kalibrierung der CCD-Kamera, Aufgaben
Durchführung der Datenreduktion
Teilversuch: Farbenhelligkeitsdiagramm eines Sternhaufens
Teilversuch: Lichtkurve eines Bedeckungsveränderlichen
Teilversuch: Oberflächenphotometrie einer Galaxie
Teilversuch: Spektralklassifikation von Sternen
Einführung für alle Teilversuche
Allgemeine Vorbemerkung
Von den vier angebotenen Versuchen soll nur jeweils einer durch eine Gruppe durchgeführt werden. Dieser soll vorzugsweise mit eigenen Beobachtungen am Nachthimmel durchgeführt werden. Verhindert schlechtes Wetter die nächtlichen Beobachtungen, so sollen Sie zumindest die Kalibration des Detektors selbst durchführen und diese auf Archivdaten anwenden. Anschließ end erfolgt die spezifische astronomische Auswertung gemäß Ihrem speziellen Teilversuch. Die Handhabung des Teleskops, des Detektorsystems, seine Kalibrierung sowie die Durchführung der Beobachtungen einschließ lich ihrer Vorbereitungen sind für alle Versuche jedoch so ähnlich, daß sie hier gemeinsam beschrieben werden.
Die Auswahl des konkreten Versuchs erfolgt durch den Leiter des Praktikums nach Maß gabe der Beobachtbarkeit der Objekte während der Semesterzeit sowie in Abstimmung auf die anderen Aufgaben, die von der Gruppe durchgeführt werden.
Sinn des Versuches
Sinn und Zweck dieser Teilversuche im Vergleich zu den anderen angebotenen Aufgaben ist es, die Praktikumsteilnehmer noch näher an die tatsächliche Beobachtungspraxis in der optischen Astronomie heranzuführen. Daher werden hier nicht (oder nur teilweise) vorbereitete Daten zur Bearbeitung angeboten oder Simulationen ermöglicht, sondern es sind mit einer CCD-Kamera am Schmidt-Teleskop selbst Beobachtungen durchzuführen und diese anschließ end zu reduzieren. Dazu gehört auch ein Funktionstest sowie die Kalibrierung der CCD-Kamera.
Der Reiz der Versuche liegt sicher in der Durchführung der Beobachtungen;
hier liegen aber auch die Probleme:
München-Bogenhausen bietet nur sehr bedingt astronomisch brauchbare Beobachtungsbedingungen. Daher sind der eigenen Beobachtung Grenzen gesetzt, d.h., im allgemeinen kann nur ein Teilaspekt der Beobachtungen selbst durchgeführt werden. So muß z.B. die photometrische Kalibration des Versuchs 'Sternhaufen' wie des Versuchs 'Galaxienphotometrie' aus der Literatur entnommen werden. Auch müssen wir uns auf scheinbar helle Objekte beschränken, was aber den zu lernenden Prinzipien keinen Abbruch tut. Wegen der ungünstigen Umweltbedingungen wurden die in Bogenhausen aufgestellten Teleskope schon lange nicht mehr modernisiert. Die Studenten sollten sich darüber im klaren sein, daß moderne Beobachtungen nicht nur an größ eren, sondern insbesondere auch elektronisch anders ausgerüsteten und im allgemeinen computergesteuerten Teleskopen stattfinden. Natürlich nimmt diese moderne Ausrüstung einem nur die lästigen Grundprinzipien hilfreich ab, die hier im Versuch noch von Hand durchgeführt werden müssen (etwa das Einstellen am Teilkreis mit selbst errechneter Sternzeit bzw. Stundenwinkel). Die Prinzipien bleiben natürlich die gleichen und sind hier sogar offensichtlicher nachvollziehbar.
Frage: Ihnen ist sicher bekannt, daß die beobachtende, erdgebundene Astronomie Standorte fern der Universitätsinstitute aufgebaut hat und benutzt. Benennen Sie hier sowohl für die optische Astronomie als auch für die Radioastronomie Gründe, die diesen Aufwand rechtfertigen. Machen Sie sich die Konsequenzen für Ihre eigenen Messungen in München klar.
Durchführung der Beobachtungen
Beobachtungen erfordern oft sehr umfangreiche Vorbereitungen. Ein erheblicher
Teil dieser Vorbereitungen dient der konkreten Formulierung der
wissenschaftlichen Fragestellungen, die dann festlegt, mit welchem
prinzipiellen Instrumentarium und in welcher speziellen Konfiguration
beobachtet wird. Dies ist Ihnen hier bereits vorgegeben (siehe Teilversuche).
Ferner müssen die Beobachtungsobjekte sinnvoll ausgewählt werden:
Koordinaten und Zeitpunkt
Ihnen wird eine Liste geeigneter Objekte im Teilversuch zur Verfügung
gestellt. Aus diesen sollten diejenigen auswählt werden, die zum Zeitpunkt
Ihrer Beobachtung in Meridiannähe stehen. Auf Grund der Bewegung der Erde
um die Sonne als auch der Rotation der Erde sind hierfür sowohl das Datum
als auch die Uhrzeit der Beobachtung wichtig. Konsultieren Sie ggfs. ein
Einführungslehrbuch, um sich die Koordinatensysteme nochmals zu
verdeutlichen!
Die Abweichung vom Meridian wird durch den Stundenwinkel HA gemessen. Er
ergibt sich als Differenz der Rektaszensions-Koordinate RA des
Objektes sowie der Sternzeit ST:
HA = ST - RA
Die Sternzeit - eine Ortszeit! - gibt
die Ablage des sogenannten Frühlingspunktes (also des
Koordinatenursprungs) vom Meridian des Beobachtungsorts zum
Beobachtungszeitpunkt an. Beim
Berechnen des Stundenwinkels transformieren Sie also die bezüglich des
Himmels festen Koordinaten in Teleskopkoordinaten. Dies müssen Sie
auch bei der Beobachtung durchführen! Am Teleskop stellen Sie HA
und Deklination - die zweite Koordinate - ein. HA ist im Moment des
Einstellens zu berechnen. Dazu steht Ihnen am Teleskop eine Sternzeituhr
zur Verfügung. Beachten Sie, daß an Teleskopen mit Teilkreisen
mit einer Teilung in  gearbeitet wird und diese in Minuten unterteilt
werden. Nach obiger Formel negative HA sind also mit einer mod(24)-Rechnung
in positive Werte zu überführen.
gearbeitet wird und diese in Minuten unterteilt
werden. Nach obiger Formel negative HA sind also mit einer mod(24)-Rechnung
in positive Werte zu überführen.
Zur Planung der Beobachtungen können Sie sich einer
einfachen Faustformel bedienen. Am 21. September eines jeden Jahres
passiert um Mitternacht Ortszeit die Rektaszension  den Meridian.
Einen Monat später ist dann RA =
den Meridian.
Einen Monat später ist dann RA =  usw. (
usw. ( . Wenn Sie also am
7. Dezember um
. Wenn Sie also am
7. Dezember um  beobachten wollen, ist um Mitternacht die RA im
Meridian ungefähr
beobachten wollen, ist um Mitternacht die RA im
Meridian ungefähr  , um
, um  also
also  . HA ist möglichst
so zu wählen, daß das Objekt meridian-nah, also möglichst hoch am
Himmel steht (s.u.). Ein Objekt mit einer RA von
. HA ist möglichst
so zu wählen, daß das Objekt meridian-nah, also möglichst hoch am
Himmel steht (s.u.). Ein Objekt mit einer RA von  hätte in unserem
Beispiel also einen HA =
hätte in unserem
Beispiel also einen HA =  und wäre zu diesem Zeitpunkt nicht
empfehlenswert.
und wäre zu diesem Zeitpunkt nicht
empfehlenswert.
Frage: Was müssten Sie am Teilkreis einstellen?
Frage: Was müssen Sie unternehmen, um das Objekt bei
 trotzdem zu beobachten?
trotzdem zu beobachten?
Wie wäre es mit einem Objekt bei  ? Unter Beachtung von mod(24)
erhalten Sie HA =
? Unter Beachtung von mod(24)
erhalten Sie HA =  , ein meist noch tolerierbarer Wert - sofern
Ihre Messungen nicht zu lange dauern. Denn während der Messung wird
die HA natürlich ständig größ er. Ein guter Beobachter zeichnet
sich dadurch aus, daß er (oder sie) dafür Sorge trägt, daß
die Messungen möglichst symmetrisch zum Meridian stattfinden und
abgeschlossen sind, bevor grosse Distanzen zum Zenit erreicht sind. Hierbei
ist ggfs. nicht nur die reine Integrationszeit, sondern auch 'Totzeiten'
zu berücksichtigen (Einstellzeit des Teleskop, Zeit zum Wechsel der
Instrumentenkonfiguration, Zeit für das Speichern der Daten etc.).
, ein meist noch tolerierbarer Wert - sofern
Ihre Messungen nicht zu lange dauern. Denn während der Messung wird
die HA natürlich ständig größ er. Ein guter Beobachter zeichnet
sich dadurch aus, daß er (oder sie) dafür Sorge trägt, daß
die Messungen möglichst symmetrisch zum Meridian stattfinden und
abgeschlossen sind, bevor grosse Distanzen zum Zenit erreicht sind. Hierbei
ist ggfs. nicht nur die reine Integrationszeit, sondern auch 'Totzeiten'
zu berücksichtigen (Einstellzeit des Teleskop, Zeit zum Wechsel der
Instrumentenkonfiguration, Zeit für das Speichern der Daten etc.).
Erdatmosphäre und optische Beobachtungen
Wieso soll man meridian-nah beobachten? Speziell auf dem Sternwartengelände
sind Sie durch die prachtvollen Bäume hierzu gezwungen, die nur nahe
des Zenits den Himmel freilassen. Auß er in der Nordrichtung sind in etwa
nicht mehr als  Zenitdistanz möglich. Auf allen Observatorien
gelten hingegen die nachfolgenden Gründe, die alle mit Effekten der
Erdatmosphäre zu tun haben:
Zenitdistanz möglich. Auf allen Observatorien
gelten hingegen die nachfolgenden Gründe, die alle mit Effekten der
Erdatmosphäre zu tun haben:
 . Auch dies läß t sich leicht graphisch verstehen.
Schließ lich nimmt die Extinktion vom Roten zum Blauen stark zu.
. Auch dies läß t sich leicht graphisch verstehen.
Schließ lich nimmt die Extinktion vom Roten zum Blauen stark zu.
Frage: Welche Effekte auß er der atmosphärische Unruhe tragen zur beobachteten point spread function eines Teleskops bei? Bei welchen Teleskopen sind sie die einzigen Abbildungsfehler?
Frage: Welche Methoden kennen Sie, um die erläuterten Effekte des Seeings zu unterdrücken? Wie wirken diese im Rahmen des oben genannten einfachen Models?
Frage: Stellen Sie sich vor, daß Sie bei Anwesenheit von atmosphärischer Dispersion mit einem Spaltspektrographen ein Spektrum aufnehmen wollen, bei dem weder der blaue noch der rote Teil des Spektrums überproportional abgeschnitten sein soll. Was ist zu tun?
Die beschriebenen Effekte behindern Beobachtungen. So beschränkt Seeing das Auflösungsvermögen zum Teil erheblich und kann dazu führen, daß die Bilder von Haufensternen ineinander verschmieren. Eine Ermittlung der individuellen Sternhelligkeiten wird damit schwieriger und fehlerhafter. Der Durchzug auch feinster Wolken mindert die Menge der registrierten Photonen und verfälscht so den Vergleich von Messungen unbekannter Objekte (die zu untersuchen sind) und bekannter Eichquellen - man spricht von nichtphotometrischen Bedingungen. Auß erdem wird das Signal-Rausch Verhältnis gleich zweimal beeinträchtigt: Man bekommt weniger Photonen vom Objekt, gleichzeitig kann der Hintergrund wesentlich gesteigert werden, wenn die Wolken Streulicht (Mond, irdisches Licht) in den Teleskopstrahlengang reflektieren. Verschiedene Meß programme haben also unterschiedliche Ansprüche: Die Lichtkurve einer veränderlichen Quelle können Sie mit der CCD-Kamera auch durch leichte Cirrus-Wolken noch verfolgen, da die Standards (nahegelegene Feldsterne) simultan mitgemessen werden, die Eichung der Farbenhelligkeitsdiagramme der Sternhaufen ist nicht möglich. Schlechtes Seeing beeinfluß t die Oberflächenphotometrie der Galaxien im Zentrum stark, auß en hingegen wenig usw.
Bis auf die tatsächlichen technischen Handgriffe für das Teleskop
(nächster Abschnitt) und den Detektor (übernächster Abschnitt)
wissen Sie nun fast alles, um die Beobachtungen zu machen:
Auf einen speziellen Effekt der Durchführung hier in München sei noch mal hingewiesen. Der Nachthimmel in München ist extrem hell und verhindert daher längere Belichtungen, wie sie eigentlich angemessen wären. Unterteilen Sie daher die angestrebte Belichtungszeit in einzelne Aufnahmen, die zusammen die gewünschte Gesamtbelichtungszeit ergeben. Dabei soll nach Möglichkeit in jeder Aufnahme das Rauschen im Hintergrund durch das Photonennoise bestimmt sein (und nicht durch das Ausleserauschen, mehr siehe unten). Nach Lesen der unten angegebenen Literatur sollten Sie mit Ihrem Betreuer die Vor- und Nachteile des Verfahrens diskutieren. Es wird an groß en Observatorien mit sehr dunklem Nachthimmel angewandt, um zu den schwächsten Quellen vorzudringen.
Frage: Warum?
Handhabung von Teleskop und CCD-Kamera
Die nun folgenden Ausführungen sind als Check-Liste zu verstehen. Bei unerwarteten Problemen (z.B. Rechnerabsturz, Stromausfall) müssen Sie an einer sinnvollen Stelle wieder einsteigen, am Ende der Beobachtungen das Instrumentarium wieder in einen witterungssicheren Zustand versetzen, in dem Sie diese Liste (teilweise) rückwärts durchlaufen.
 zu drehen, danach schwenken
Sie das Teleskop zum Zenit. Abweichend hiervon verfahren Sie beim Aufnehmen
von Flatfields und Dunkelstrommessungen: Belassen Sie das Teleskop in der
vorgefundenen Position und decken Sie die Eintrittsapertur mit dem vorhandenen
Stofftuch ab, das als Mattscheibe dient. Sorgen Sie für eine sehr schwache
Beleuchtungsquelle (z.B. Schreibtischlampe mit einem Abstand von nur 0.5 cm
gegen die Wand strahlen lassen.
zu drehen, danach schwenken
Sie das Teleskop zum Zenit. Abweichend hiervon verfahren Sie beim Aufnehmen
von Flatfields und Dunkelstrommessungen: Belassen Sie das Teleskop in der
vorgefundenen Position und decken Sie die Eintrittsapertur mit dem vorhandenen
Stofftuch ab, das als Mattscheibe dient. Sorgen Sie für eine sehr schwache
Beleuchtungsquelle (z.B. Schreibtischlampe mit einem Abstand von nur 0.5 cm
gegen die Wand strahlen lassen.
Kurz-Anleitung CCD-Camera Kalibrierung
Durchführung der Datenreduktion
Der Ihnen zur Verfügung stehende Computer ist die hal5, der account
ist prakt04. Das zur Zeit gültige Password teilt Ihnen der Betreuer
mit. Nachdem Sie sich eingeloggt haben legen Sie bitte eine sub-directory
für Ihre Arbeiten an, die als solche klar erkenntlich ist, am besten über
den Namen eines Gruppenmitglieds:
mkdir mustermann
und setzen sich auf dieses:
cd mustermann
Nunmehr bereiten Sie den PC vor! Dazu verbinden Sie den PC mit dem
Computernetzwerk des Instituts, indem Sie durch Ihren Betreuer die
dazu nötige Steckverbindung herstellen lassen.
Danach transferrieren Sie die Beobachtungsdaten mittels ftp vom PC auf
die Workstation auf Ihr sub-dir. Dazu verlassen Sie auf dem PC der CCD
Kamera das Steuerprogramm ( EXIT im Menü File). Setzen Sie sich
nun am PC auf Ihr eigenes Sub-Directory. Nunmehr am PC:
ftp hal5
login prakt04
aktuelles Passwort
bin
mput *.fit
quit
Nunmehr stehen die Daten in einer Form zur Verfügung, in der sie mit allen
gängigen Bildverarbeitungssystemen manipuliert werden können. Ein in
der optischen Astronomie in Europa häufig benutztes System ist das bei
der Europäischen Südsternwarte in Garching entwickelte System MIDAS,
das wir hier benutzen werden. Um es zu starten, setzen Sie den Befehl
inmidas 01
ab. Dieser ist so nur am einem X-Terminal oder einer Workstation-Konsole
gültig! Nach einigen Augenblicken wird Ihnen gemeldet, dass Sie nunmehr
unter MIDAS arbeiten, und der Prompt wechselt.
Im Prinzip können Sie sich nun mit help über die verfügbaren
Kommandos informieren und mit help Kommando sowohl die Syntax als auch
eine Beschreibung erfahren. Zusammen mit dem Wissen aus den Kapiteln des
Buches von Mclean wären Sie also in der Lage, die geforderten Aufgaben
zu erledigen. Allerdings ist der Hintergrund zu einem mehrere hundert Kommandos
umfassenden Bildverarbeitungssystem wie MIDAS derart komplex, daß Ihnen
hier ein kleines Menü von Kommandos und eine Art Kochrezept angeboten wird,
um die Aufgaben lösen zu können. Dabei halten wir uns an das einfachste
Grundschema. Zunächst eine Auflistung für Sie nützlicher Befehle:
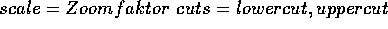
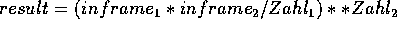
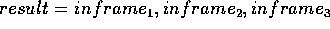
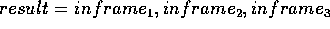 med
med
Hier nun ein Beispiel, um eine Aufnahme eines Sternfeldes in einen Filter
komplett zu korrigieren, die für andere Aufgaben geforderten Wege können
Sie hieraus ableiten. Generell der Hinweis, daß die Benennung der frames
Ihnen im Rahmen dessen, was Sie beim Befehl intape/fits beachten mussten,
frei steht, möglichst 8 Zeichen aber nicht überschreiten sollte. Die Namen
im folgenden Beispiel sind also instruktive Stellvertreter.
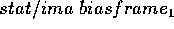
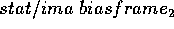
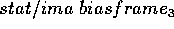
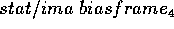
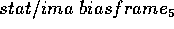
Wenn alle bias-frames im Rahmen der Statistik übereinstimmen:
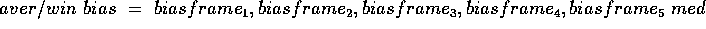
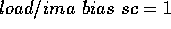
Hat bias Struktur? Wenn ja müssen Sie die anderen frames mit dem bias-frame
korrigieren, sonst reicht der Abzug des Mittelwertes!
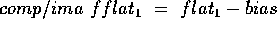
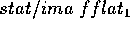
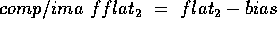
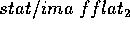
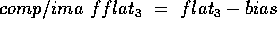
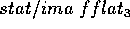
etc.
Im Falle des Linearitätstest notieren Sie diese Werte (Mittelwert,  )
zusammen mit der Belichtungszeit (auf Papier und/oder in Tabelle, siehe Help)
für Ihre Auswertung, folgende Schritte nicht nötig).
)
zusammen mit der Belichtungszeit (auf Papier und/oder in Tabelle, siehe Help)
für Ihre Auswertung, folgende Schritte nicht nötig).
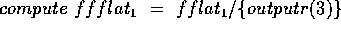
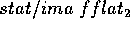
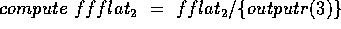
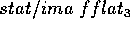
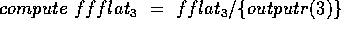
etc.
Hier wurde eine weiterführende Möglichkeit ausgenutzt: Das Ergebnis von
stat/ima wird temporär im Keyword outputr gespeichert, der Mittelwert ist
in dessen drittem Element. Halten Sie die hier gegebene Reihefolge ein! Sinn
der Operation ist die Normierung des Flats auf ein mittleres Niveau von 1.
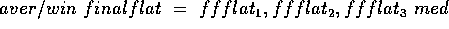
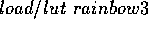
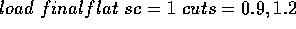
Beurteilen Sie, ob die Erarbeitung des mittleren Flats gutgegangen ist oder
irgendwelche Fehler passiert sind.
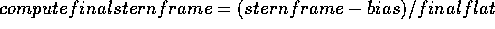
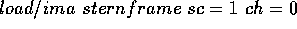
Probieren Sie gute 'cuts' aus und führen Sie das Kommado nochmals aus!
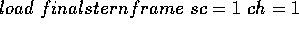
Auch hier für gute cuts sorgen! Ggfs benutzen:
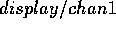
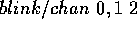
Vergleichen Sie qualitativ die Güte der Korrektur! Abbrechen von blink/chan
mit mittlerer 'mouse'-Taste.
Nunmehr wenden Sie sich den Aufgaben ihres Teilversuches zu (wenn Sie alle
Stern-frames korrigiert und alle Fehler beseitigt haben), also z.B. dem
Vermessen von (immer den gleichen) Standardsternen sowie ihres
Bedeckungsveränderlichen auf allen frames mit

oder der Sterne eines Sternhaufens in drei Farben. Beachten Sie,
daß Sie sich das Leben (Protokoll ohne Schreibfehler! Weitere
Rechnungen! Graphische Darstellungen) sehr viel einfacher machen, wenn
Sie sich der Midas-Tabellen bedienen (s.o. und siehe Help zu den
Befehlen). Beachten Sie ferner, daß Sie sich bei Behandlung vieler
Frames (Veränderlicher, Sternhaufen) das Leben vereinfachen
können, wenn Sie alle Frames in ein einheitliches Koordinatensystem
bringen, siehe hierzu neben center/gauss
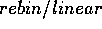 .
.
Ein letzter Hinweis: An der einen oder anderen Stelle kann durchaus etwas
schief gehen (Fehler, falsche Frames, Daten defekt etc.). Es lohnt daher,
jeden Schritt mit load/ima zu kontrollieren, so wird es auch anschaulicher
für Sie. Die hier gezeigte Korrektur beseitigt nur bias und Pixel-zu-pixel
Variationen des flats. Überlegen Sie selbst, wie sie einen wesentlichen
Dunkelstrom beseitigen können (es ist einfach!). Schließ lich kann es
sein, daß die hier gezeigte Flatkorrektur groß räumige Gradienten
beläß t. Sprechen Sie mit Ihrem Betreuer über das Problem und wenden
Sie ggfs. flat/sky an (siehe help). Wie aus obigen Beispiel deutlich, müssen
Sie für jedes Filter nur ein flat- und ein bias-frame erarbeiten, diese
dann aber u.U. auf einige dutzend 'Sternframes' anwenden. Natürlich können
Sie alle Befehle einzeln eintippen. Falls Sie sich mit einem der Editoren
auf unseren Workstations gut auskennen (z.B. emacs, vi) können Sie aber
auch ein Macro erstellen, nachdem Sie an zwei oder drei Beispielen die
Zuverlässigkeit Ihres Weges geprüft haben. Dies geht wie folgt:
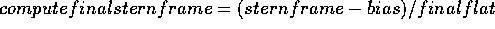
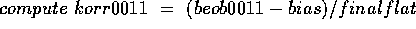
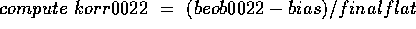
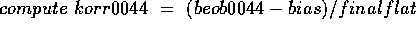
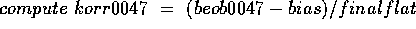
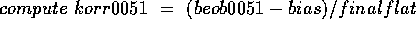
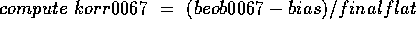
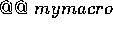 .
.
Die Teilversuche
Die Anleitungen zu den bisherigen Versuchen zu den gleichen Themen liefern Ihnen die meisten der benötigten Hinweise, die Umarbeitung auf die Durchführung mit CCD-Kamera am Teleskop wird z.Z. durchgeführt.
Ausnahme ist die Aufnahme einer Lichtkurve eines Veränderlichen Sternes, hier müssen Sie alle Informationen von Ihrem Betreuer erhalten. Er wird Sie ggfs. mit zu lesender Literatur versorgen.
Eine Bitte zum Schluß: Wie Sie der noch im Entstehen begriffenen
Anleitung entnehmen können, ist dieser Versuch noch im Aufbau. Ihre
Erfahrungen sind für uns nützlich, für Anregungen sind wir dankbar.